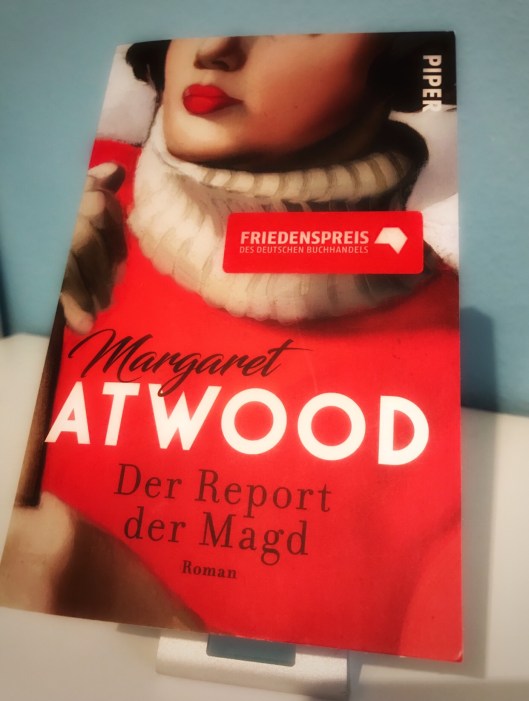Schlagwörter
Mööök.
Doppel-Mööök-Gold.
Eine Hexe aus dem 17. Jahrhundert reist direkt vom Scheiterhaufen in eine Strandparty im Jahr 2018. Von dort aus will sie ihren Liebsten retten, den sie in der Vergangenheit hat sterben sehen.
Uiiiii. Coole Storyline. Könnte man meinen. Aber der frisch erschienenen Netflix-Serie „Siempre Bruja“ („Einmal Hexe“) fehlt es irgendwie an Allem: Charme, einer schlüssigen Story, überzeugenden Darstellern. Schon direkt am Anfang ist eigentlich klar: Der nette Gefangene, der so uneigennützig hilft, ist eigentlich der Böse. Jaaaaa, gespoilert. Verklagt mich doch.
Ich möchte möchte möchte die Serie soooo gerne mögen. Es gibt das Liebespaar, den witzigen Sidekick, die Freunde… aber irgendwie kommt alles ganz plötzlich und stapelt sich ohne Kitt aufeinander.
Dabei gibt es auch durchaus launige Momente:
„Scheiterhaufen existieren nicht mehr.“
„Wie werden Zauberer DANN bestraft?“
„Es gibt hier keine Todesstrafe.“
„Keine Todesstrafe? Was ist das denn für eine Justiz?“
„Das nennt man Menschenrechte.“
„Menschenrechte? Wer hat denn sowas Blödes erfunden?“
Dennoch sind solche Momente selten und können nicht die Szenen wieder wett machen, in denen den Helden im Klassenraum auffällt, dass eine der Protagonistinnen fehlt und man „mal eben“ im Unterricht versucht, sie anzurufen. Whoooot? Künstlerische Freiheit – Ja. Aber das hier ist einfach nur total albern.
Außerdem hat die Serie mit Übersetzungsfehlern zu kämpfen. Das Original ist Spanisch. Da meins allerdings nur für den Einkauf auf dem Markt im mallorquinischen Santanyi reicht, läuft die englische Tonspur mit deutschen Untertiteln (denn auch das Verhältnis Geräusch/Sprachspur lässt teilweise zu wünschen übrig). Und da stellt der geneigte Zuschauer dann fest: Nicht immer ist die deutsche Übersetzung die dessen, was da gesprochen wird.
Ich hatte mich auf eine launige Hexenserie gefreut. Bekommen hab ich schöne Bilder aus der Karibik. Kann man machen. Muss man nicht.
Mööök.

Foto: Netflix

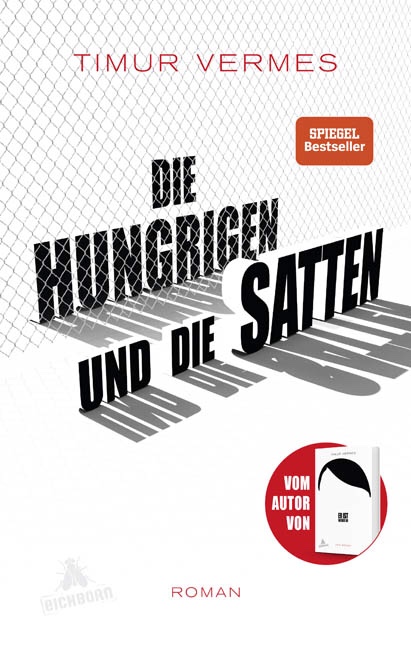
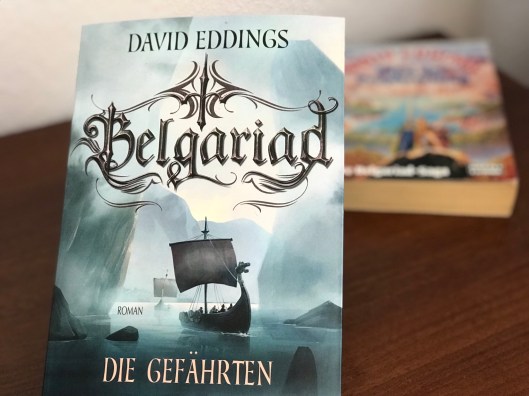 Das Cover der Neuauflage. Hinten rechts: meine heißgeliebte, mittlerweile arg vergilbte 1998-er Auflage
Das Cover der Neuauflage. Hinten rechts: meine heißgeliebte, mittlerweile arg vergilbte 1998-er Auflage